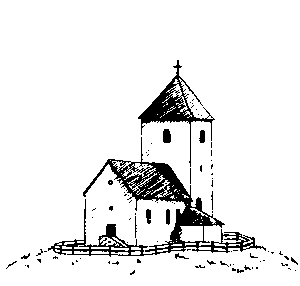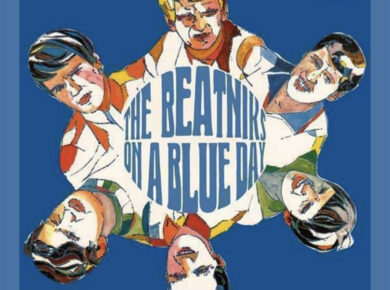Eine Kirche, eine Gastwirtschaft, eine Handvoll Bergbauern. Das ist St. Oswald heute. Vor Jahrhunderten stand der Name für einen belebten und unermesslich reichen Bergbauort im Oberen Lavanttal.
In der Sommerau, einem Bergdorf, das neun Kilometer von Reichenfels entfernt liegt, erinnert heute nichts mehr an den sagenhaften Reichtum von einst. Man hat eher das Gefühl, auf dem Weg zu den Zwergen hinter den sieben Bergen zu sein. Was nicht ganz falsch ist, wenn man bedenkt, dass oft eben dort von Zwergen erzählt wurde, wo Bergknappen am Werke waren.
Auf der kurvigen Bergstraße, die zur ehemaligen Silbermine führt, kommt man an einem geheimnisumwitterten Felsen vorbei, den der Teufel hierher geschleudert haben soll. Eigentlich wollte er damit Gläubige von ihrer Christenpflicht abbringen, aber er verfehlte sein Ziel. Übrigens, nicht das einzige Mal, und so gibt es im Lavanttal eine Reihe von ziemlich ähnlichen Sagen.
 Mindestens so spannend sind die geheimnisvollen Ritzzeichen am Teufelpredigtstuhl, wie der Felsen genannt wird. Was die Kreuze, Quadrate, Zahlen, Tierfüße bedeuten, ist nicht geklärt. Die einen tippen auf Gaunerzinken, die anderen vermuten, dass es oberitalienische Bergleute aus dem „Welschland“ waren, die im 15. Oder 16. Jahrhundert auf der Suche nach seltenen Metallen oder Edelsteinen hier vorbeikamen und einen Fundort markierten. Direkt beim Felsen scheint aber niemand gegraben zu haben. Vielleicht auch deshalb, weil die Knappen wenige Kilometer weiter leichter zu Gold und Silber gekommen waren. Davon gab es, wie gesagt, früher nämlich jede Menge.
Mindestens so spannend sind die geheimnisvollen Ritzzeichen am Teufelpredigtstuhl, wie der Felsen genannt wird. Was die Kreuze, Quadrate, Zahlen, Tierfüße bedeuten, ist nicht geklärt. Die einen tippen auf Gaunerzinken, die anderen vermuten, dass es oberitalienische Bergleute aus dem „Welschland“ waren, die im 15. Oder 16. Jahrhundert auf der Suche nach seltenen Metallen oder Edelsteinen hier vorbeikamen und einen Fundort markierten. Direkt beim Felsen scheint aber niemand gegraben zu haben. Vielleicht auch deshalb, weil die Knappen wenige Kilometer weiter leichter zu Gold und Silber gekommen waren. Davon gab es, wie gesagt, früher nämlich jede Menge.
Heute sind auf dem Weg in die Sommerau vor allem kleine Rinnsale, Felsen, ausgedehnte Wälder zu sehen. Und nach jeder Kurve noch mehr davon. Man ist geneigt, dem Navi zu misstrauen, und sicher, falsch zu sein. Bis man überraschenderweise doch am Ziel ist und am Fuße des kleinen Kegels steht, auf dem die Oswaldikirche thront: Ein klobiger Turm mit Pyramidenhelm, der sich an den massiv gebauten Kirchenraum lehnt. Gebaut, um Wind und Wetter 1.000 Jahre lang zu trotzen. Die Szenerie erinnert an die sanften Hügel Irlands und daran, dass Kultorte stets auf einem Kraftplatz errichtet wurden.
 Eine Kirche, eine Gastwirtschaft, eine Handvoll Bergbauern. Das ist St. Oswald heute. Schwer vorstellbar, dass hier einst eine Boom-Town lag. Ein Ort, der seine Gründung und sein Wachstum unvorstellbaren Gold-, Silber- und anderen Erzvorkommen verdankte. Kaiser, Fürsten und Bischöfe rissen sich um die Gegend und die Knappen war so reich, dass sie nicht nur die Kirche in der Sommerau erbauten. Mit dem Gold wurden auch die Kunigundenkirche in Bad St. Leonhard und das Priesterhaus in Klagenfurt errichtet.
Eine Kirche, eine Gastwirtschaft, eine Handvoll Bergbauern. Das ist St. Oswald heute. Schwer vorstellbar, dass hier einst eine Boom-Town lag. Ein Ort, der seine Gründung und sein Wachstum unvorstellbaren Gold-, Silber- und anderen Erzvorkommen verdankte. Kaiser, Fürsten und Bischöfe rissen sich um die Gegend und die Knappen war so reich, dass sie nicht nur die Kirche in der Sommerau erbauten. Mit dem Gold wurden auch die Kunigundenkirche in Bad St. Leonhard und das Priesterhaus in Klagenfurt errichtet.
Seit einem Einbruch in den 1980er-Jahren ist der Zugang in die älteste Oswaldikirche Kärntens durch eine mächtige Metalltüre und die Tatsache erschwert, dass man erst den Mesner erreichen muss. Der lebt nebenan und öffnet Kirche und Gastwirtschaft für angekündigte Gäste und an besonderen Kirchenfesten. Zum Beispiel am 5. August, dem Festtag des Hl. Oswald, einem der berühmtesten Kirchtage des Tales.
 Im Inneren lässt sich die wechselvolle Geschichte von Bau, Brand, Neubau, Aufstieg und Niedergang anhand von Relikten aus Romanik (Grundriss), Gotik (Netzrippengewölbe) und Barock (Gemälde) nachvollziehen. Auch die Auswahl der Heiligenstatuen und -bilder verrät einiges aus der Vergangenheit: Die kleine Statue des Hausheiligen Oswald mit Rabe und Ring steht symbolisch für eine lange Geschichte, die von Liebe, Glaube und Kampf handelt und gut ausgeht. Barbara mit dem Turm, der sich die Bergleute anvertrauten, die Pestheiligen Rochus und Sebastian, die in den Zeiten der großen Seuchen um Hilfe gebeten wurden. Und ganz oben am Hauptaltar ist ein Paar porträtiert, dem man immer wieder begegnet, wenn man entlang der Lavant unterwegs ist: Kaiser Heinrich II. und seine Frau Kunigunde, die 1007 das Bistum Bamberg gründeten.
Im Inneren lässt sich die wechselvolle Geschichte von Bau, Brand, Neubau, Aufstieg und Niedergang anhand von Relikten aus Romanik (Grundriss), Gotik (Netzrippengewölbe) und Barock (Gemälde) nachvollziehen. Auch die Auswahl der Heiligenstatuen und -bilder verrät einiges aus der Vergangenheit: Die kleine Statue des Hausheiligen Oswald mit Rabe und Ring steht symbolisch für eine lange Geschichte, die von Liebe, Glaube und Kampf handelt und gut ausgeht. Barbara mit dem Turm, der sich die Bergleute anvertrauten, die Pestheiligen Rochus und Sebastian, die in den Zeiten der großen Seuchen um Hilfe gebeten wurden. Und ganz oben am Hauptaltar ist ein Paar porträtiert, dem man immer wieder begegnet, wenn man entlang der Lavant unterwegs ist: Kaiser Heinrich II. und seine Frau Kunigunde, die 1007 das Bistum Bamberg gründeten.
Dazu gehörte seit dem 11. Jahrhundert auch das ganze Obere Lavanttal, das durch seine Bodenschätze für die fränkischen Kirchenfürsten interessant war. Irgendwann war in der Sommerau, in Reichenfels und in den Nachbarorten Bad St. Leonhard und Kliening Schluss mit dem Reichtum. Warum? Einige Sagen begründen das Aus mit übermütigen, gottlosen und/oder gewalttätigen Knappen und Fürsten, die mit einem Fluch bestraft worden sein sollen und auf diese Weise ihre Bodenschätze mit einem Mal los waren.
In Wirklichkeit wurden in der neuen Welt größere Gold- und Silbervorkommen entdeckt und die Erzlager im Lavanttal waren einfach erschöpft. Man schürfte tiefer und tiefer, bis das Wasser die Stollen flutete und ein Schacht nach dem anderen geschlossen wurde. Mitte des 18. Jahrhunderts endete die Geschichte des Silber- und Goldbergbaus im Lavanttal. Und ziemlich genau zu dieser Zeit verabschiedeten sich die Bamberger. Zur Freude des Hauses Habsburg, denn die bambergischen Besitzungen lagen mitten im eigenen Hoheitsgebiet. Am 5. Mai 1759 wurde der Vertrag unterzeichnet und Maria Theresia kaufte das Obere Lavanttal um 1 Million Gulden Silber.