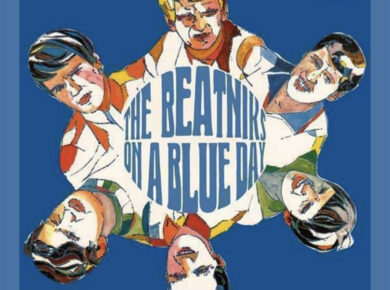Die Burg über der Stadt Wolfsberg bewohnten schon Bamberger und Habsburger, ehe Hugo Graf Henckel von Donnersmarck das Wahrzeichen der Stadt zu einem imposanten Schloss umbauen ließ.
Die neugotische Tudor-Architektur stammt aus dem 19. Jahrhundert, davor stand vermutlich schon seit dem 11. Jahrhundert eine Burg am Hügel. Wer sie gebaut hat, ist unbekannt. Die Geschichtsschreibung erzählt nur, dass König Heinrich II. im Jahr 1007 dem Hochstift von Bamberg ausgedehnte Ländereien in Kärnten schenkte, zu denen auch Wolfsberg gehörte. Und in einer Urkunde von 1178 ist von Fridericus de Wolfsperch die Rede. Vermutlich ein Beamter der Bamberger Bischöfe, der mit den Benediktinern von St. Paul im Streit war und der Stadt zu ihrer ersten urkundlichen Erwähnung verhalf.
 Von der mittelalterlichen Burg hatte man die weitläufigen Besitzungen zwischen Koralm und Saualm gut im Blick und hinter den dicken Mauern waren die Verwalter und ihre Untergebenen sicher geschützt. Im 16. Jahrhundert wurde der mächtige Südwestturm aufgestockt und die Befestigungsanlage erweitert. Als Maria Theresia 1759 den gesamten bambergischen Besitz erwarb, wechselte auch die Stadt Wolfsberg und die weithin berühmte Burganlage in den Besitz der Habsburger. Ihr Sohn Josef II. übergab Wolfsberg dem Religionsfonds, der aus dem Erlös der Verkäufe und Versteigerungen des Besitzes der aufgehobenen Klöster gebildet wurde. Ein Rechtsakt mit Folgen. Denn ein Großteil der wertvollen Inneneinrichtung und zahlreiche Kunstwerke verschwanden kurz darauf in den kaiserlichen Sammlungen.
Von der mittelalterlichen Burg hatte man die weitläufigen Besitzungen zwischen Koralm und Saualm gut im Blick und hinter den dicken Mauern waren die Verwalter und ihre Untergebenen sicher geschützt. Im 16. Jahrhundert wurde der mächtige Südwestturm aufgestockt und die Befestigungsanlage erweitert. Als Maria Theresia 1759 den gesamten bambergischen Besitz erwarb, wechselte auch die Stadt Wolfsberg und die weithin berühmte Burganlage in den Besitz der Habsburger. Ihr Sohn Josef II. übergab Wolfsberg dem Religionsfonds, der aus dem Erlös der Verkäufe und Versteigerungen des Besitzes der aufgehobenen Klöster gebildet wurde. Ein Rechtsakt mit Folgen. Denn ein Großteil der wertvollen Inneneinrichtung und zahlreiche Kunstwerke verschwanden kurz darauf in den kaiserlichen Sammlungen.
Bessere Zeiten erlebte die Burg, als die deutsche Industriellenfamilie Rosthorn die Gebäude 1825 kaufte, restaurierte und 1846 an den preußischen Adeligen Hugo Graf Henckel von Donnersmarck weiterverkaufte. Hugo eins, wie er in der Familie heißt. Auf der Rückreise von einer Kur an der Adria mit seiner Frau Laura querte er das Lavanttal zur Zeit der Apfelblüte und war von der Landschaft hin und weg, wie man sich erzählt.

Der damals 35-Jährige, der als erfolgreicher Unternehmer auf Expansionskurs war, kaufte Bergbaubetriebe in der Umgebung – und das Schloss. Kurz darauf beauftragte er die renommierten Wiener Architekten Johann Romano und August Schwendenwein von Lanauberg mit dem Umbau der Anlage im Tudor-Stil. Genauer gesagt war es der Tudor Revival-Stil, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als modern galt und Elemente aus der englischen Architektur der Tudorzeit – Ende des 15. bis Ende des 16. Jahrhunderts – übernahm. Als Reaktion auf die Baustile unter Königin Victoria, wie manche meinen, oder als Protest gegen die Massenproduktion des Industriezeitalters.
Auf der Baustelle am Hügel fanden viele Handwerker aus der Umgebung Arbeit, andere Könner der unterschiedlichsten Zünfte holte Graf Hugo für sein Prestigeprojekt extra ins Lavanttal. Viele blieben der Region auch nach der Fertigstellung erhalten – und damit auch ihr handwerkliches Können.
Nach sieben Jahren war das Schloss kaum wiederzuerkennen. Steinmauern waren gesprengt und durch hell verputzte Ziegelbauten ersetzt, die sich heute vom Grün des Schlossparks abheben. Das Abbruchmaterial wurde in den alten Wehrgraben geschüttet und neben den alten Türmen im Osten und Süden stand nun auch ein achteckiger Turm im Norden, wie alle anderen Gebäudeteile von Zinnen gekrönt. Dazu kamen eine neugotische Torhalle mit einem Treppenhaus, ein Geschoß mit den privaten Räumen der Gräfin Laura, während Graf Hugo im zweiten Stock wohnte, Treppen, die die Niveauunterschiede ausglichen, und repräsentative Räume: das Speisezimmer mit Stuckmarmor oder der Salon mit riesigen Spiegeln und der Kassettendecke.
„Hugo war wohlhabend und wollte mit dem Umbau ein deutliches Zeichen setzen. Zum anderen sollte das Schloss Hauptsitz der Familie werden“, erzählt Andreas Henckel von Donnersmarck, Graf Hugos Urururenkel. Doch es kam anders.
Nach Hugos Tod verließen zwei Söhne das Lavanttal aus unterschiedlichen Gründen. Beide übersiedelten nach Polen. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg entschied die weitverzweigte Familie, das Anwesen in den Besitz von Hugos Nachfolgeunternehmen, der Kärntner Montanindustrie, zu übergeben. Und dabei blieb es.
Glanz und Gloria des einstigen Prachtbaus schwanden zusehends. Nach dem Weltkrieg logierten die britischen Besatzungstruppen im Schloss, später wurden die Räume vermietet. Als Andreas Henckel von Donnersmarck die Sommer mit seinen Eltern und Großeltern im Lavanttal verbrachte, wohnte man im Schloss „mit Bassena am Gang und Räumen, die durch Kartonwände getrennt waren“.
 Anfang der 1990er übersiedelte er mit seiner jungen Familie nach Wolfsberg. „Damals fraß sich der Hausschwamm durch die Holzbalken der Beletage. Die Räume waren teilweise unbewohnbar und für heutige Verhältnisse zu groß dimensioniert“, erinnert sich der Hausherr an den Anfang der Restaurierungsarbeiten, die ihn jahrzehntelang in der neben dem Beruf verbleibenden Freizeit beschäftigten.
Anfang der 1990er übersiedelte er mit seiner jungen Familie nach Wolfsberg. „Damals fraß sich der Hausschwamm durch die Holzbalken der Beletage. Die Räume waren teilweise unbewohnbar und für heutige Verhältnisse zu groß dimensioniert“, erinnert sich der Hausherr an den Anfang der Restaurierungsarbeiten, die ihn jahrzehntelang in der neben dem Beruf verbleibenden Freizeit beschäftigten.
Sein Engagement für das Familienjuwel und das Wahrzeichen der Stadt hat sich gelohnt, wie der Lokalaugenschein und die Faszination von Gästen und Einheimischen zeigen. „Aber es bleibt eine Herausforderung, so ein Haus zu bewohnen und zu bewirtschaften.“ Mit seiner Frau und den vier Kindern bewohnt Henckel von Donnersmarck nur einen kleinen Teil der 6.000 Quadratmeter. Einen Teil belegen die Büros der Kärntner Montanindustrie und in den repräsentativen Räumen der Beletage ist heute das Schloss Restaurant untergebracht. Den elliptischen Kuppelsaal mit den weißen Stuckornamenten und den Nussholzvertäfelungen sowie die benachbarten historischen Räume mietet die Stadt jeden Sommer, um Werke renommierter Kunstschaffender wie zuletzt Manfred Bockelmann und Walter Melcher zu zeigen. In der übrigen Zeit können die Prunkräume für Bälle und andere Veranstaltungen gemietet werden. Die „moderne Nutzung für ein anachronistisches Gebäude“, wie es Henckel von Donnersmarck beschreibt, scheint gelungen.
Das historische Ensemble und der weitläufige Schlosspark, wo Graf Hugo einige Jahre lang auch einen Wildpark eingerichtet hatte, gelten mittlerweile als beliebtes Naherholungsgebiet. Dass der Park zu den bedeutendsten gartenarchitektonischen Anlagen des Landes zählt, ist vermutlich den wenigsten bewusst, die auf den beschatteten Wegen vom Stadtzentrum durch den Park hinauf zum Schloss und weiter auf den Wanderwegen zum Mausoleum unterwegs sind.
 Erbaut wurde das Grabmal für Hugos Ehefrau Laura, die am Weihnachtsabend 1857 im Alter von 45 Jahren verstorben war. Mit der Planung beauftragte der Witwer den preußischen Hofarchitekten Friedrich August Stüler. Die klassizistische Statue auf dem Sockel stammt vom norddeutschen Bildhauer August Kiss, der den Sarkophag nach dem Vorbild des Grabmals der preußischen Königin Luise in Charlottenburg gestaltete. Wenn man sich im Schloss für eine Führung anmeldet, kann man auch das Innere des prächtigen Kuppelbaus sehen, in dem Laura und einige ihrer Nachfahren bestattet sind.
Erbaut wurde das Grabmal für Hugos Ehefrau Laura, die am Weihnachtsabend 1857 im Alter von 45 Jahren verstorben war. Mit der Planung beauftragte der Witwer den preußischen Hofarchitekten Friedrich August Stüler. Die klassizistische Statue auf dem Sockel stammt vom norddeutschen Bildhauer August Kiss, der den Sarkophag nach dem Vorbild des Grabmals der preußischen Königin Luise in Charlottenburg gestaltete. Wenn man sich im Schloss für eine Führung anmeldet, kann man auch das Innere des prächtigen Kuppelbaus sehen, in dem Laura und einige ihrer Nachfahren bestattet sind.
Andere Familienmitglieder fanden am kleinen Friedhof nebenan ihre letzte Ruhe. Aber auch langgediente Mitarbeiterinnen der Familie. Wie Miss Sarah Eliza Goodland oder Gertrud Gawlik. „Eine Kammerzofe der Großtante“, erklärt Andreas Graf Henckel von Donnersmarck. Die Oberschlesierin Gawlik begleitete die Familie ins Lavanttal und blieb hier bis an ihr Lebensende.
Fotos © N. Popp, Schloss Wolfsberg: C.StadlerBwag