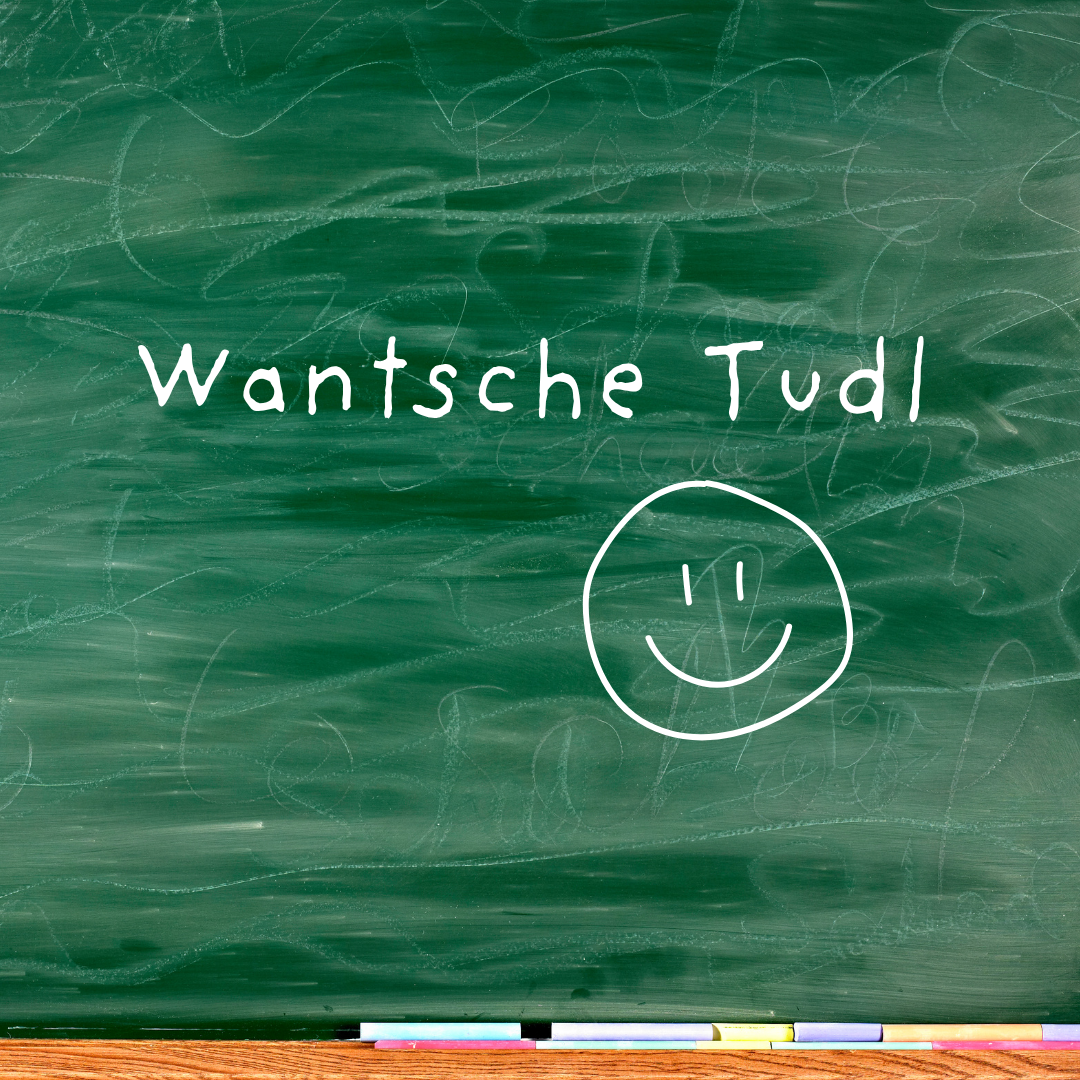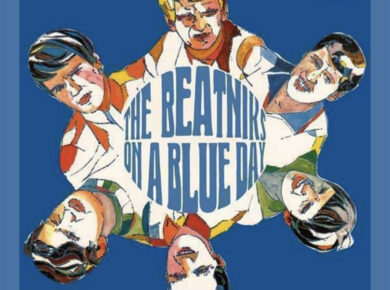Wer im Lavanttal angekommen ist, merkt das auch mit geschlossenen Augen.
Man hört es.
Wenn „Hiesige“ sprechen, klingt das wie ein Singsang, der kärntnerisches und steirisches Vokabular und Intonation verbindet und daraus etwas Eigenes, Unverwechselbares schafft.
Der Dialekt, der die Region früher einmal so klar typisiert hat, ist mittlerweile seltener zu hören. Aber das Lavanttalerische apert wie die Glimmerfelsen am Koralmhang in der Frühjahrssonne doch immer wieder aus. Die Sprache beschreibt lautmalerisch Bilder und spielt mit einer Bandbreite an Um- und Rachenlauten, die Ungeübte beim Nachsprechen vor schier unüberwindbare Herausforderungen stellt. Gymnastik für Zunge, Gaumen, Stimmbänder und die Muskulatur des gesamten Kieferbereichs.
Den Dialekt mit „Bellen“ abzutun, wird der Gesamtleistung auf gar keinen Fall gerecht.
Die Geschichte des Dialekts hängt mit der Topografie des Tales zusammen. Von den übrigen Teilen Kärntens und der Steiermark ist die Gegend durch mehr als 2.000 m hohe Berge getrennt. Diese klare Trennung hat die Sprache, die Kultur, das Arbeitsleben und vermutlich auch das Wesen der Menschen zwischen Kor- und Saualm geprägt und tut es immer noch, wie viele meinen.
Die Sprache bzw. der Dialekt hat sich natürlich wie in ganz Österreich auch im Lavanttal verändert. Social Media und Gilmore Girls hinterlassen eben ihre Spuren. „Random“ (einfach so), „fail“ (fehlerhaft, schlecht) und „cringe“ (peinlich) zählen auch hier im Süden zum Standard-Sprech der Jungen. Man kommt mit weniger Worten aus, verzichtet auf Präpositionen, setzt auf Wiederholungen. Mit kleinen Abweichungen, zugegeben.
Das „Oida“ dehnt sich in der Lavanttaler Variante zum langgezogenen „Oooulda“. Einen früher einmal typischen Willkommensgruß wie „Geäz när incher!“* hört man heute selten.
„Echtes Lavanttalerisch sprechen nur mehr Menschen über 80, die über 1.000 m Seehöhe in einer Landwirtschaft leben“, beschreibt Martin Haider den Status quo. Als Besitzer einer Fahrschule kommt er viel in der Region herum. Auch über 1.000 Meter. Irgendwann hörte er das Wort „Bochmulta“. „Irgendwas mit Bach“, dachte er zunächst, aber dann übersetzte sein Gegenüber das Vokabel mit „Teigschüssel“. Auf „Bochmulta“ folgten „Weschgi“*, „fortn“, „darbi Sülchn“*.

„Jedesmal, wenn ich einen Ausdruck hörte, den ich nicht kannte, habe ich sofort nach der Bedeutung gefragt und beides auf einem Zettel notiert.“ Wobei sich die Geister bei der Schreibweise von Begriffen wie „scharbln“*, „Irti“* oder „letz banånd“* scheiden. Denn das „å“ hört sich hier eher nach „ou“ an und das „i“ oft nach einem „r“, das im Hals stecken geblieben ist, und das „ü“ wird gern durch ‚u“, „i“, „ia“ oder überhaupt durch eine eigene Wortschöpfung ersetzt. Aus „Schüssel“ wird dann „Schissl“, aus „Brücke“ wird „Bruggn“, „dafür“zu „dafia“ und die „Pfütze“ zur „Lockn“. Und wenn im übrigen Kärnten zumeist von „Dirndle“, „Dirndale“ oder „Dirnlan“ die Rede ist, so schwärmen Lavanttaler Originale vom „liabn Dinli“. Analog wird das „Zuckale“ zum „Zickili“ und das „Glasale“ zum „Glasili“.
Dialekt eignet sich eben vorzugsweise fürs Reden. Weil aber in Vergessenheit gerät, was nicht aufgezeichnet wird, hat Martin Haider seine Zettelsammlung vor einigen Jahren geordnet und seinen Vokabelschatz als Buch veröffentlicht. „Du Off du! Lovnttolarisch verständlich gemacht.“ Wie’s zum Titel kam?
„Das ist eine oft gehörte Floskel, die den Rest des Satzes irgendwie verstärkt“, erklärt Haider. In der Region versteht man’s offensichtlich und findet Gefallen an der Sammlung des leidenschaftlichen Wortklaubers und Zuhörers. Von Band eins sind nur mehr wenige Exemplare erhältlich und mittlerweile erschien bereits „Du Off du! Zwa“ mit vielen Wortspenden aus dem Lavanttal.
Eine andere Lavanttalerin, die sich der Mundart verschrieben hat, lebt auf 1.000 m Seehöhe. Geboren am Kamperkogel am Koralmhang, verbrachte Edith Kienzl ihre Kindheit im kleinen Dorf Lading auf der Saualm. Nach ihrer Heirat wechselte sie als Bäuerin wieder auf die andere Seite der Lavant. Seither lebt und arbeitet sie in Obergösel.
„Vulgo Gumper“ steht auf dem Hofschild, das verrät, dass das Navi doch die richtigen Abzweigungen angezeigt hat. Zweifel waren – zugegeben – vorhanden. Denn der Weg führt von Frantschach hinauf an ein Ende der Welt. Ringsum nichts als Wiesen, Wald und Gegend. „Das ist nicht das Ende der Welt“, widerspricht Edith Kienzl mit einem gewinnenden Lachen. „Bei uns fångt sie ån.“ Humor ist nicht nur der rote Faden ihrer Gedichte.
Martin Haiders Befund vom direkten Zusammenhang zwischen 1.000 m Seehöhe und solider Dialekt-Kompetenz dürfte stimmen. Das allein reicht aber nicht zum Dichten. „Deutsch war immer schon mein Lieblingsfach“, erzählt die Bäuerin, die gerne Lehrerin werden wollte. Aber dann lernte sie ihren Mann kennen und entschied sich für Landwirtschaft und Familie. Fürs Schreiben und Lesen blieb vorerst wenig Zeit. Nur hin und wieder unternahm die junge Bäuerin Ausflüge mit den Frauen der Umgebung. Weil sie von nüchternen Reiseberichten wenig hielt, verpackte sie die Erlebnisse in unterhaltsame Mundartgedichte. „Das Leben ist oft ernst genug. Schon damals wollte ich unterhalten und Freude bereiten.“

Edith Kienzls dichterisches Talent sprach sich herum. Zunächst schrieb sie Muttertagsgedichte, damit „die Kinder beim Aufsagen mehr Spaß haben und die Eltern nicht immer das Gleiche hören müssen.“ Dann klopfte die Nachbarschaft an, weil ein runder Geburtstag vor der Tür stand. Seither schreibt die Lavanttalerin Gedichte für Jubiläen und Hochzeiten, Adventfeiern und Ortsfeste. „Immer im Dialekt, mit Humor und einer Pointe“, beschreibt sie den roten Faden ihrer Texte. Meistens geht ihr das Schreiben leicht von der Hand. „Dauert es einmal länger, bis die Geschichte rund ist, denk’ ich beim Melken weiter.“ Und wenn das richtige Wort nicht und nicht daherkommt, holt sie ihren Schatz aus der Lade: Franz Tatschls Sammlung alter Lavanttaler Worte. Das um 1920 verfasste Buch ist eine wahre Fundgrube, in der sich auch längst vergessene Ausdrücke finden.
Irgendwann wollte Edith Kienzl ihre Gedichte in einem Buch veröffentlichen und sie vertraute sich ihrer ehemaligen Zeichenlehrerin Annemarie Dacar an. Die gab ihr den Rat, von den Beziehungen zwischen den Menschen zu erzählen, unverwechselbare Charaktere zu beschreiben und die Natur und die Schönheit der Region in Reime zu verpacken. Edith Kienzl nahm sich den Rat zu Herzen und gab der damals über 70-jährigen Lehrerin ihrerseits eine Nuss zu knacken: Illustrationen für die „Gedichtlan“. Und so entstand das erste von mittlerweile fünf illustrierten Gedichtbänden, in denen sie wortgewaltig und humorvoll die menschliche Natur in all ihren Facetten in Reime fasst. Hoppalas von Kindern, Mann und Frau im Dauer-Clinch, komische Käuze und Berufskrankheiten, Tiere, Feste und all das, was im Tal passiert und passiert sein könnte.
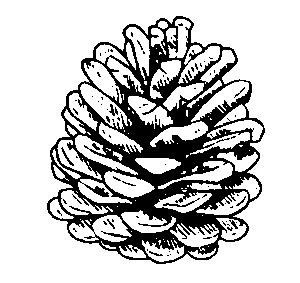
Übersetzung: Lavanttalerisch – Deutsch
*Wantsche Tudl – fesche Frau
*Geäz när incher! – Kommt nur herein!
*Weschgi – dummer Mensch, auch: Togga, Todl, Hougga
*Fortn – Vorjahr
*darbi Sülchn – träger Mensch
*scharbln – blättrig schneiden
*Irti – Dienstag
*letz banånd – in schlechtem Zustand
Akustische Bodenproben
Wie Lavanttaler Dialekt klingt? So.
Im Lavanttal-Podcast erzählen Martin Haider und Edith Kienzl natürlich auch im Dialekt über ihre Beziehung zur Sprache und vom Leben in einer der schönsten Gegenden Kärntens.
- #1 Loch a bissl – Ein Gespräch mit der vermutlich bekanntesten Bergbäuerin des Tales, Edith Kienzl
- #17 Der mit den Wölfen tanzt – Zu Besuch bei Martin Haider, hellhöriger Wortklauber, Fahrschulbesitzer und Stadionsprecher des WAC
Lavanttal Storys – Lavanttalerisch Lektion 1 & 2 mit Edith Kienzl
Ein Ausflug auf die Koralm oder die Saualm – man setze sich in ein Wirtshaus, das über 1.000 m Seehöhe liegt, und höre den Gästen und Wirtsleuten einfach zu.